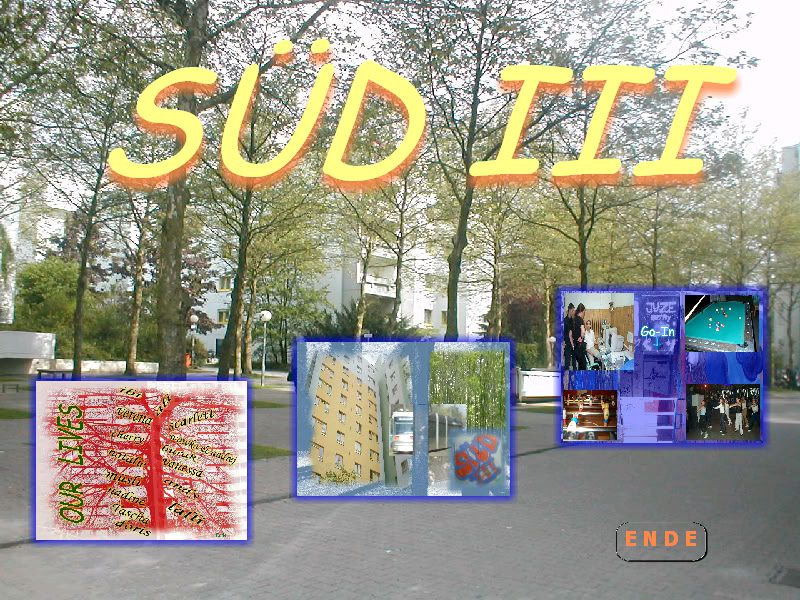Süd III inside
Zentrales Lernziel eines Projektes im Jugendhaus „Go-In“ in Darmstadt-Eberstadt war, zur Erweiterung der Wahrnehmungskompetenz beizutragen, eine audiovisuelle Reflexion über das eigene Selbstbild anzuregen und den persönlichen Sozialraum sowie die Lebenswelt unter anderen Gesichtspunkten komplexer erkennen zu können. Bei dem Projekt wurde davon ausgegangen, dass die Jugendlichen die objektiven Parameter ihrer Lebenswelt subjektiv deuten. Die Formen ihrer Aneignung sind beeinflusst von der sozialräumlichen Struktur der jeweiligen Lebenswelt, aber auch von ihren biographischen sowie ihren Medien-Erfahrungen. Der Sozialraum ist eine „gewachsene, gelebte Struktur innerhalb geografisch bestimmbarer Grenzen, in denen sich die Interaktions- und Deutungsmuster der Adressaten … abbilden“ (Klawe 2000, S. 439). Der Lebensraum, die bewusst erlebte Konstruktion der
Wirklichkeit der Jugendlichen rekonstruiert sich auf Grund von Erfahrungen in diesem Sozialraum. Der Lebensraum ist somit immer nur ein Teil des Sozialraumes. Das Projekt dient dazu, sich in einem Selbstlernprozess anhand eigener Recherchen weitere Segmente des Sozialraums zu erschließen. Durch Fotografieren und Videografieren eignen sich die Jugendlichen in tätiger Auseinandersetzung ihren Sozialraum an. Bisher fremde Orte werden ihnen vertraut, die Möglichkeiten, die in ihrem Sozialraum liegen, werden ihnen erst durch das Abbild (vireales Denken) bewusst. Gleichzeitig dienen die Aufnahmen den Erwachsenen als Indikator für die Seh- und Wahrnehmungsweisen der Jugendlichen sowie deren Bedürfnisse und Interessen. Neben der sozialräumlichen Erkundung sollten handlungsorientierte Kompetenzen im Umgang mit Multimedia erlernt werden.


Zugleich sind die Projekte Realtime-Lernen für StudentInnen im Rahmen ihrer sozialpädagogischen Ausbildung. Sowohl die Jugendlichen als auch die StudentInnen, die das Projekt vor Ort in dem Jugendzentrum betreuten, waren autonom Lernende. Gelernt wurde im Rahmen eines offenen Curriculums. Meine Aufgabe bestand in der Generierung der Lernumgebung (Projektdesign, Mittelbeschaffung, Verhandlungen mit dem Kooperationspartner, Sicherstellung der Infrastruktur), der beratenden Betreuung der Studierende und der Präsenz bei den Projekttagen. Eine weitere Ebene bestand in dem Nachweis, dass Offene Jugendarbeit nicht zwangsweise „Abhängen“, „Zeit totschlagen“ oder „gelebte Langeweile“
sein muss. Es sollte gezeigt werden, dass Jugendliche, wenn ihre Themen angesprochen, ihre Denk- und Wahrnehmungsweisen berücksichtigt werden, durchaus Interesse haben, sich mit sich selbst und ihrer konkreten Lebenswelt auseinander zu setzen. Jugendliche mit ausländischer Herkunft und sozialer Benachteiligung weisen oftmals nicht nur Defizite in der sprachlich-rationalen, sondern auch in der audiovisuell-alphanumerischen Kommunikation auf. Damit sie in der Wissensgesellschaft nicht ausgegrenzt werden, ist Medienkompetenz für diese Zielgruppe von hoher Bedeutung. Das Projekt reagiert genau auf diese Problem-Schnittstelle.
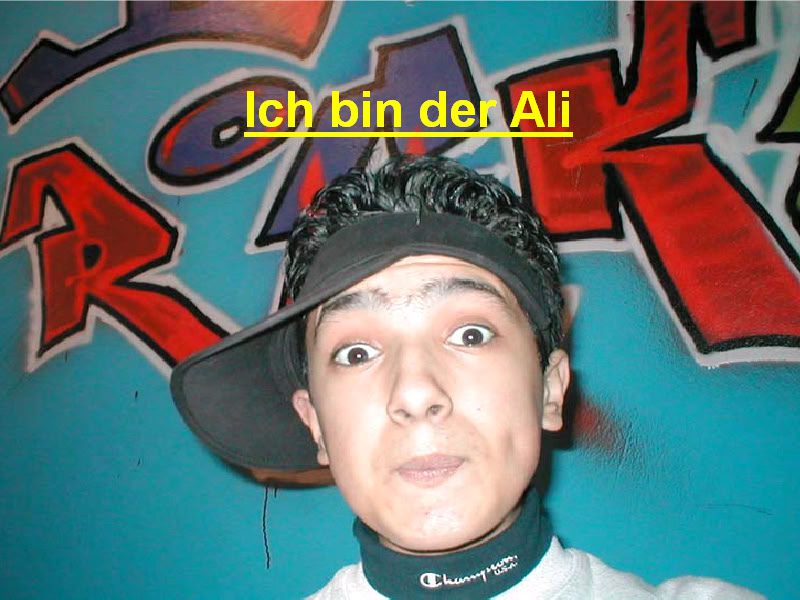

Mittels der eigenständigen Bearbeitung von Multimedia-Seiten für eine interaktive CD erlebten sich die Jugendlichen als kompetent. Im Rahmen eines Selbstlernprozesses, bei Bedarf flankiert von Hilfestellungen seitens der StudentInnen, lernten sie sich mit einer in unserer Gesellschaft hoch anerkannten Kommunikationsform auszudrücken. Nicht auf der expliziten, sondern auf der impliziten Ebene, und damit auf spielerische Weise, erlernten die Jugendlichen den Umgang mit dem Computer. Sie lernten die Auge-Hand-Koordination und die Interaktion mit Bildschirmmenüs. Sie digitalisierten Text, Bild, Grafik und Video zu Daten, banden diese Daten in Seiten ein und vernetzten die Seiten zu einem hypermedialen Text. Sie machten sich vertraut mit der ästhetischen Gestaltung von Multimedia-
Seiten und wurden dabei sensibilisiert, die Wirkung von gestalterischen Ausdrucksmitteln wahrzunehmen. Sie erwarben dabei wichtige Schlüsselqualifikationen, die sie bei ihren späteren beruflichen Tätigkeiten einsetzen können. Nach Abschluss des Projektes erhielten sie nicht nur von ihrer Peergroup Anerkennung. Alleine durch die öffentliche Präsentation unter Beisein der Presse und der Sozialdezernentin der Stadt Darmstadt, die ihre Verwunderung über die Professionalität der CD-ROM und deren anspruchsvolle ästhetische Gestaltung deutlich zum Ausdruck brachte, wurde ihr Selbstbewusstsein gestärkt, und sie erfuhren Anerkennung und Bestätigung ihrer Selbstwirksamkeit nicht nur innerhalb ihrer PeerGroup, sondern auch von anderen Personen.